|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
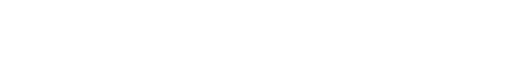 |
 |
|
|
|
 |
Projekte
Was geplant ist, was in Arbeit ist ...
und was demnächst auf der Website veröffentlicht wird
|
 |
|
|
|
 |
- "Das Vergleichen mit nichts!"
Der Mensch, der die Welt vernünftig anschaut und daran geht, sich in ihr zu orientieren und zu verhalten, muss ihre Amorphie als allererstes immer ordnen, strukturieren oder in eine Form bringen. Dieses Ordnen geschieht zunächst durch Vergleichen. Vergleichen ist nicht nur ein elementares geistiges Tun des Menschen im Allgemeinen, sondern es steht auch im Besonderen am Beginn jeder wissenschaftlichen Forschungsarbeit.
Alles kann miteinander verglichen werden! - In der öffentlichen Diskussion aber begegnet uns regelmäßig heftiger Streit um die Berechtigung von Vergleichen. Einerseits werden sie polemisch als falsch, unsinnig oder böse abgewehrt, andererseits dazu benutzt, Menschen einen Glorienschein zu verleihen oder sie vom Podest zu stürzen. Besonders in der "medialen Öffentlichkeit" sind Vergleiche zu einem probaten Instrument der Subjektivität oder Willkür herabgesunken. Der Streit um das Vergleichen kann zuweilen so weit eskalieren, dass behauptet wird, etwas sei unvergleichlich oder mit nichts zu vergleichen. Mit diesen Urteilen ist aber das Denken in ein Extrem gegangen, dass das Vergleichen ad absurdum führt. Denn das Unvergleichliche ist nur unvergleichlich als Ergebnis eines Vergleichs mit allem und was mit nichts zu vergleichen ist, erlischt dem Gedanken nach zu einem leeren Abstraktum oder ist selbst nichts.
Der Aufsatz "Das Vergleichen mit nichts!" behandelt die Notwendigkeit und die uneingeschränkte Berechtigung zum Vergleichen. Dabei wird aber auch auf die inneren Widersprüche des Vergleichens eingegangen, sowie die Problematik der aus einem Vergleich hergeleiteten Urteile und Schlüsse erörtert.
|
 |
|
|
|
 |
- "Der Eigendünkel des auf die Spitze getriebenen Individualismus der Gegenwart"
Der gesunde Menschenverstand spricht: "Ich bin ich, niemandes Eigentum. Ich bin frei, wenn ich tun und lassen kann, was ich will." Mit solchen Behauptungen artikuliert sich das Prinzip des Individualismus. Seine Grundlage ist die Vorstellung der Vereinzelung, des Geteilt-Seins des Universums in elementare für sich genommene Ganzheiten (Ein Elementarteilchen ist wohl Teil eines Ganzen, für sich genommen kann es aber kein Teil mehr sein).
Genauso wie der Verstand das Universum als ein Kollektiv elementarer Teilchen auffasst, begreift er die Gesellschaft als Nebeneinander menschlicher Individuen (atomarer Teilchen) und menschliche Gemeinschaften wie Familie, Nation, Volk oder Staat zunächst als nichts anderes als die Zusammenfassung der einzelnen menschlichen Individuen unter einem formalen, äußerlichen Gesichtspunkt zu Kollektiven. Das innerliche Band, durch das ein Kollektiv zu einer Verbindung, zu einer Einheit Unterschiedener wird oder zu etwas qualitativ Neuem und Selbständigen, bleibt dieser Auffassung unbekannt oder erscheint ihr als irrational.
Nach Überzeugung des "Individualismus" ist jedes Individuum in einer menschlichen Gemeinschaft in Wahrheit für sich, allein, ein einzelner. Die Einzelheit muss zur Geltung gebracht werden; sie gilt als Selbstverwirklichung. Vor meiner Einzelheit verblasst selbst die Sonne! Ob nun als Versprechen der Politik "Wohlstand für alle" (nicht allgemeiner Wohlstand), ob in der Durchführung von Chaostagen oder sog. Love-parades, ob in Slogans wie "Mein Bauch gehört mir", dem proklamierten Recht auf Bedürfnisbefriedigung im Gegensatz zu Triebverzicht oder in der Beurteilung von Macht- und Karrierestreben, Gier im allgemeinen sowie Geiz als "geil", zeigt sich, wie der Zeitgeist der westlichen Staaten, wo nicht einmal mehr die gemeinsame Bedürfnisbefriedigung die Individuen verbindet, in das Extrem der Einzelheit gegangen ist.
Für den Individualismus ist das "wahrhaft" Soziale, das Sein des Menschen nur durch den anderen, ein Gräuel. Der Individualist will nur noch Mensch sein, sich von nichts mehr bestimmen lassen. So aber ohne Bestimmung, unbestimmt, reine Einzelheit, erlischt der Mensch zu einem toten Abstraktum.
Die Spitze aber, der Dünkel und die Eitelkeit der Einzelheit, zeigt sich, wenn sie in der Überzeugung, die gesellschaftlichen Ordnungen wie die der Familie, natio, Volk oder Staat seien von himmlischen oder irdischen Despoten ersonnene Zwangsordnungen, versucht, die Einzelheit als Prinzip und Ordnung über die Ordnung der Natur und die der anderen Menschen, die sich als Ordnung aller ergeben hat, zu stellen.
Ein Essay, das die Dinge aufsucht und auffasst, den Gedanken der Sache folgt und beides zusammen in seiner Entwicklung darstellt. Weil aber das andere der Vereinzelung, die Verbundenheit, nicht thematisiert und ausgeführt wird, bleibt die Darstellung hier zunächst negativ. (Weiteres folgt in dem Essay: "Der Mensch ein Zoon Politikon")
|
 |
|
|
|
 |
- "Der Mensch ein Zoon Politikon"
Der Mensch ist ein Zoon Politikon, ein soziales, politisches Wesen! - Dieses Urteil des Aristoteles als Theorie begriffen begründet Sozialwissenschaften wie Soziologie, Sozialpsychologie, Sozialpsychiatrie oder Politologie, und wenn es nicht ihr Grund ist, so wird es doch als Prämisse selbst bei partikulären empirischen Forschungsgegenständen vorausgesetzt.
Während dieses Urteil gegenwärtig als Theorem, als Theorie über einen empirisch gegebenen Sachverhalt gilt, weil die Dinge an sich nicht zu erkennen sind, ist es bei Aristoteles "Theoria", reines Erkennen, ein Urteil des Begriffs. Es ist Metaphysik, aber eine eines ganz anderen Kalibers als die gegenwärtige, als die die Theorie bezeichnet werden muss.
Nach Aristoteles ist der Mensch ein lebendes Wesen (!), dessen Bestimmung es ist, sich in einem Gemeinwesen, d.h. durch seine Beziehung auf andere Menschen und seine Verbindung mit ihnen zu verwirklichen. Es gibt ihn als bewusste Individualität nur durch die anderen. Ja, er könnte nicht einmal "ich" sagen, weil "ich" nur als verbindende und ausgrenzende Beziehung auf das Du ist. (Jacobi, Hegel, Buber).
Dieser längere Artikel über den Menschen, der nur wirklicher Mensch ist durch seine Verbundenheit mit anderen, d.h. durch einen "Staat", setzt nun keine Kenntnis der Philosophie des Aristoteles, Jacobis, Hegels oder Bubers voraus. Die Idee des Zoon Politikon wird vielmehr in seinen wesentlichen Bestimmungen entwickelt. Dabei wird auch immer der Frage nachgegangen, wieweit der demokratische Staat Deutschland der Gegenwart denn nun wirklicher Staat ist oder das Individuum seiner Bestimmung nach in ihm lebt, bzw. leben kann.
|
 |
|
|
|
 |
nach oben ...
|
 |
|
Druckbare Version
|
|
|

